Satellitengestützte Navigationssysteme gelten als Rückgrat moderner Ortung. Doch wachsende Abhängigkeit, Störanfälligkeit und geopolitische Risiken lenken den Blick auf GNSS-Alternativen. Inertialsensorik, terrestrische Funkortung, bildgestützte Navigation und Zeitdienste aus dem Boden- oder Mobilfunknetz gewinnen rasant an Relevanz.
Inhalte
- Trends bei GNSS-Alternativen
- Technische Stärken und Limits
- Sicherheitsaspekte und Risiken
- Einsatzszenarien und Kosten
- Empfehlungen zur Auswahl
Trends bei GNSS-Alternativen
Multi-Layer-PNT ersetzt zunehmend die alleinige Satellitennutzung: Terrestrische Funksignale, LEO-Konstellationen, 5G, UWB und visuell-inertiale Verfahren werden zu hybriden Lösungen verschmolzen. Treiber sind Resilienz gegen Jamming/Spoofing, Authentifizierung von Signalen, städtische Abschattung sowie die Nachfrage nach kontinuierlicher Zeit- und Lageintegrität in Industrie, Logistik, Automotive und Drohnen. Parallel wächst die Einbindung von Edge/Cloud zur Qualitätsprüfung, während On-Device-Algorithmen Energie sparen und Datenschutzanforderungen berücksichtigen.
- LEO-basiertes PNT: Nutzung von Doppler/Mehrfrequenz-Beobachtungen der Megakonstellationen als Signals-of-Opportunity für robustes Timing und Meter-Level-Position.
- eLoran: Langwelle als landesweite, schwer störbare Zeit-/Positionsebene; Wiederaufbau in Pilotregionen für kritische Infrastrukturen.
- 5G-Positionierung: NR-PRS, OTDOA und Winkelmessungen liefern Meter- bis Dezimeter-Level in Campus- und Stadtszenarien.
- UWB: Zentimetergenaue Indoor-Ortung für Asset-Tracking, Robotik und AR; zunehmend in mobile SoCs integriert.
- Wi‑Fi RTT/BLE AoA: Kostengünstige Indoor-Abdeckung durch vorhandene Netze, geeignet für dichte Deployments.
- Visuelle/Inertial-Navigation: Kameras und IMUs stabilisieren Trajektorien, map-basierte Lokalisierung schließt Lücken in GNSS-Schattenzonen.
Kommerzielle Entwicklungen fokussieren auf Sensorfusion auf Chip- und Plattformebene, offene Integritätsmetriken via API, und Standardisierung (3GPP, IEEE 802.15.4z, maritime R‑Mode). PNT-as-a-Service bündelt Netze, Karten und Qualitätsmonitoring; Energieeffizienz, Privacy-by-Design und Zertifizierungen prägen Ausschreibungen. Im Zusammenspiel mit ADAS, UTM und Industrie-4.0-Stacks entstehen skalierbare, geprüfte Fallback-Ketten für kontinuierliche Verfügbarkeit.
| Technologie | Typ | Reichweite | Genauigkeit | Reifegrad |
|---|---|---|---|---|
| LEO-PNT | Satellit (LEO) | Global | ~1-5 m | Pilot/Skalierung |
| eLoran | Terrestrisch (Langwelle) | Landesweit | ~50-100 m | Regionaler Rollout |
| 5G NR | Mobilfunk | Stadt/Campus | ~0,3-3 m | Marktreif |
| UWB | Kurzstrecke | Gebäude | ~0,1-0,3 m | Marktreif |
| Wi‑Fi RTT | WLAN | Gebäude | ~1-2 m | Weit verbreitet |
| Visuell/IMU | Onboard-Sensorik | Lokal | ~0,1-0,5 m (relativ) | Marktreif |
| R‑Mode | Maritim (MF/VHF) | Küstenzone | ~10-30 m | Pilot |
Technische Stärken und Limits
Alternative PNT-Technologien entwickeln sich von Nischenlösungen zu zentralen Bausteinen robuster Navigations-Stacks. Durch die Kombination aus terrestrischen Signalen, Sensordaten und Kommunikationsnetzen entsteht ein redundantes Lagebild, das satellitenbasierte Verfahren ergänzt. Zu den prägenden Bausteinen zählen eLoran (langwellige, tief eindringende Signale mit starker Zeitbasis), UWB (dezimetrische Indoor-Positionierung über TDoA/ToF), 5G-Positionierung (cm‑bis‑dm im dichten Small-Cell-Netz), Wi‑Fi RTT (meternahe Genauigkeit mit Standard-Hardware), LEO-Doppler/ToA über Kommunikationskonstellationen, Vision/SLAM für kartenbasiertes Relokalisation sowie IMU/Dead‑Reckoning und CSAC‑Holdover zur Überbrückung von Ausfällen.
- Robustheit: Langwelle und LEO-Doppler sind weniger anfällig für Jamming/Spoofing als schwache MEO-Signale.
- Gebäudegängigkeit: eLoran und Wi‑Fi/5G tragen Position und Zeit in urbanen Canyons und Indoor-Umgebungen.
- Genauigkeit: UWB und 5G liefern cm-dm, Wi‑Fi RTT und LEO bieten praxistaugliche Meterbereiche.
- Zeit/Frequenz: eLoran und CSAC stabilisieren Netze, Synchronisation und Sensorfusion.
- Verfügbarkeit: Signale des Alltags (Wi‑Fi, Mobilfunk) reduzieren Spezialhardware und Kosten.
Die Grenzen ergeben sich aus Infrastruktur, Physik und Governance. Hohe Präzision erfordert dichte Anchor‑Netze (UWB) oder Small Cells (5G), Vision/SLAM bleibt map‑ und lichtabhängig, und IMU driftet ohne exogene Korrekturen. Multipath und NLOS wirken in Städten weiterhin störend; Regulierung, Spektrum und Interoperabilität bestimmen die Skalierung. Energieverbrauch, Datenschutz sowie Sicherheitszertifizierungen (z. B. für kritische Dienste) setzen weitere Leitplanken. In der Praxis zählt die Diversität der Sensoren und die enge Kopplung in der Filterkette, um Verfügbarkeit, Integrität und Kontinuität in Echtzeit zu sichern.
| Technologie | Genauigkeit | Stärken | Limits | Reife |
|---|---|---|---|---|
| eLoran | 10-100 m | Tiefe Gebäudedurchdringung, Timing | Infrastruktur, regionale Abdeckung | Reaktiviert/Regional |
| UWB | 10-30 cm | Indoor-Präzision, geringe Latenz | Anchor-Dichte, NLOS | Breit verfügbar |
| 5G Position | cm-dm | Dichte Netze, Dual-Use | Coverage, Betreiberabhängigkeit | Rollout |
| Wi‑Fi RTT | 1-2 m | Commodity-Hardware | AP-Qualität, Multipath | Reif |
| LEO Doppler/ToA | 1-10 m | Hohe Signalstärke, globale Präsenz | Konstellationszugang, Lizenz | Aufstrebend |
| Vision/SLAM | cm-dm relativ | GNSS‑frei, reichhaltiger Kontext | Licht/Map-Abhängigkeit | Reif (Edge) |
| IMU/DR | driftend | Sofort verfügbar, ausfallsicher | Drift ohne Korrektur | Standard |
Sicherheitsaspekte und Risiken
GNSS-Alternativen verschieben das Risikoprofil von weltraumbasierten Störungen hin zu terrestrischen und netzwerkgebundenen Bedrohungen. Funkgestützte Systeme wie eLoran, R-Mode, VDES oder 5G-PTP sind weniger anfällig für orbitale Störungen, jedoch exponiert gegenüber Spoofing, Jamming, Cyberangriffen auf Infrastruktur sowie Multipath in urbanen Canyons. Inertiale Sensoren kompensieren kurzzeitig Signalausfälle, bringen aber Drift und Kalibrierungsrisiken mit sich. Hohe Zeitsynchronisationsintegrität wird zum kritischen Faktor; Fehler von Nanosekunden können in Energie- und Finanznetzen unmittelbar Sicherheits- und Compliance-Verstöße auslösen. Robustheit entsteht durch Signalvielfalt, Authentifizierung und Integritätsmonitoring über heterogene Quellen statt durch ein einzelnes „perfektes” System.
- Spoofing/Jamming: Gefälschte Signale oder Störer zielen auf eLoran/5G/Locata; Erkennung via Mehrantennensystemen und Konsistenzprüfungen.
- Cyber-Kompromittierung: PTP/NTP-Manipulation, Router-Hijacking, unsichere Firmware; Härtung durch MACsec, 802.1X, signierte Updates.
- Drift und Sensoralterung: INS/Oszillatoren verlieren Genauigkeit; regelmäßige Rekalibrierung und Holdover-Strategien notwendig.
- Versorgungskettenrisiken: Proprietäre Komponenten und Lizenzen erzeugen Lock-in; Dual-Sourcing und SBOM-Transparenz reduzieren Abhängigkeiten.
- Regulatorik & Haftung: Zertifizierungen, Auditierbarkeit und Forensik bei sicherheitskritischen Anwendungen als wesentliche Anforderungen.
Wirksamkeit beruht auf mehrschichtiger Resilienz: kryptografische Signal-Authentifizierung (wo verfügbar), Frequenz- und Technologie-Diversität (eLoran + 5G + SoOP + INS), Integritätsmetriken (SIL/MTIE/TDEV), verifizierbare Failover- und Holdover-Profile sowie kontinuierliche Anomalieerkennung per Sensorfusion. Governance umfasst Change- und Patch-Management, Logging mit manipulationssicheren Zeitstempeln, Spektrumskoordination und klare RACI-Modelle zwischen Netzbetreibern, Geräteherstellern und Betreibern kritischer Infrastrukturen. Ziel ist nicht absolute Immunität, sondern vorhersagbare Degradation mit definierter Wiederanlaufzeit und belegbarer Integrität.
| Risiko | Beispiel | Gegenmaßnahme |
|---|---|---|
| Spoofing | Gefälschte eLoran-Pulse | Signal-Auth + Mehrquellen-Crosscheck |
| Jamming | 5G-Timing gestört | Frequenzdiversität + Filter/AGC |
| Cyber | PTP-Man-in-the-Middle | MACsec, 802.1X, Zeitsignatur |
| Drift | INS im Tunnel | Präzisions-Oszillator, Rekalibrierung |
| Compliance | Audit-Lücken | Signierte Logs, Zeitstempel-Chain |
Einsatzszenarien und Kosten
Alternativen zur satellitengestützten Positionierung entfalten ihren Nutzen überall dort, wo Signale abgeschattet, reflektiert oder gestört sind. In Hallen und dichten Metallumgebungen liefern UWB und Wi‑Fi RTT zentimetergenaue bis metergenaue Koordinaten, während Vision/SLAM mobile Roboter und Drohnen mit lokaler Präzision versorgt. In urbanen Außenbereichen stützen 5G‑Positionierung (OTDOA/RTT) und Netzwerk-Timing die Navigation, ergänzt durch LEO‑PNT und eLoran für robuste Zeit- und Positionsreferenzen. Für Tunnel, Minen und temporäre Zonen kommen Pseudolites oder UWB‑Meshes zum Einsatz; oft als Fallback oder im Rahmen einer Sensorfusion mit GNSS, um Verfügbarkeit und Integrität zu erhöhen.
- Industriehallen & Lager: UWB, Wi‑Fi RTT für AMRs, Gabelstapler, Palettenverfolgung
- Häfen & Werften: 5G‑Positionierung plus zonales UWB an Gates und Kranbahnen
- Untertagebau & Tunnel: Pseudolite/UWB‑Beacons für Streckennavigation
- Urbaner Verkehr & Smart City: 5G + LEO‑PNT mit Kartenabgleich in Häuserschluchten
- Schiene, Depots, Bahnsteige: BLE AoA/UWB zur Gleiszuordnung und Gefahrenzonierung
- Energie, Rechenzentren, RAN: eLoran/LEO‑Zeitdienste für UTC‑Synchronisation und PTP‑Holdover
Kosten variieren nach Flächengröße, Zielgenauigkeit, Stromversorgung und Betriebsmodell. CAPEX dominiert bei infrastrukturintensiven Ansätzen (UWB, Pseudolites), während OPEX bei netzbasierten Diensten (5G‑Positionierung, LEO‑PNT) und Lizenzen überwiegt. Geräte-BOM, Kalibrierung, Wartung, Batteriewechsel, Spektrumlizenzen und Integrationssoftware prägen die TCO. Wirtschaftlich sind hybride Architekturen: zonal hohe Präzision dort, wo Prozesse es erfordern, flankiert von flächiger Basiskoordinate – insbesondere bei RTLS, Safety‑of‑Life oder strengen SLA-Vorgaben.
| Technologie | Genauigkeit (typ.) | Abdeckung | Kostenindikator |
|---|---|---|---|
| UWB RTLS | 0,1-0,3 m | Indoor/Zonen | CAPEX: €€-€€€ |
| Wi‑Fi RTT | 1-2 m | Indoor (bestehendes WLAN) | CAPEX: €-€€ |
| 5G‑Positionierung | 1-3 m | Outdoor/Urban + Campus | OPEX/Subscription: €-€€ |
| LEO‑PNT | 5-20 m | Global (Outdoor‑fokussiert) | OPEX/Subscription: €-€€ |
| eLoran (Timing) | 50-100 m (Ort); ns‑Bereich (Zeit) | Regional | CAPEX niedrig, OPEX gering |
| Vision/SLAM | 0,1-0,5 m lokal | On‑Board | Geräte‑BOM: €€-€€€ |
Empfehlungen zur Auswahl
Auswahlentscheidungen profitieren von einem klaren Abgleich zwischen Einsatzumgebung, Genauigkeitsbedarf, Skalierung und Regulatorik. In komplexen Szenarien führt eine Sensordatenfusion aus Funk-, Trägheits- und Umfeldinformationen häufig zu höherer Verfügbarkeit als eine Einzeltechnologie. Besonders relevant sind Multipath-Resistenz in urbanen Schluchten, Energieprofil bei batteriebetriebenen Geräten, Wartungsaufwand im Feld sowie Interoperabilität mit vorhandenen Netzen und IT-Sicherheitsrichtlinien.
- Genauigkeit & Latenz: Zentimeter bis Meter; deterministisch vs. best effort.
- Abdeckung & Infrastruktur: On‑prem, Campus, Weitverkehr, Offshore.
- Energie & Kosten: Batterielaufzeit, CapEx/OpEx, TCO über 3-5 Jahre.
- Integrationsaufwand: API/SDK-Reife, Edge-Compute, Kalibrierung.
- Resilienz: Störfestigkeit, Jamming/Spoofing, Fallback-Pfade.
- Datenschutz & Sicherheit: On‑device Verarbeitung, Verschlüsselung, Compliance.
- UWB: Zentimeterpräzision indoor, geringe Reichweite, Tags/Anker nötig.
- Bluetooth AoA/AoD: Meterbereich, günstige Hardware, dichte Antennenfelder.
- Wi‑Fi RTT (FTM): Räume/Etagen, nutzbar mit Enterprise‑WLAN.
- 5G NR‑Positioning: Campus bis Stadt, Netzabhängigkeit, gute Mobilität.
- LEO‑SoOP (z. B. Satelliten‑Signale): Outdoor robust, Fingerprinting‑Aufwand.
- eLoran: Harte Zeitbasis/Backup, geringe Datenrate, regionale Verfügbarkeit.
- INS/DR (+ Odometrie/Baro): Tunnel/Urban, driftet ohne Korrektur.
- Visuelle/VIO‑SLAM: Autonomie indoor, licht-/sichtlinienabhängig.
| Anforderung | Option | Stärken | Grenzen |
|---|---|---|---|
| Indoor cm | UWB | Sehr präzise | Setup‑Dichte |
| Campus m‑Level | BLE AoA | Günstig | Kalibrierung |
| Stadt ohne Infra | 5G/LEO SoOP | Breite Abdeckung | Netzbindung |
| Timing kritisch | eLoran + PTP | Robust | Regionalität |
| Tunnel/Schiene | INS + Map‑Match | Kontinuität | Drift |
| Low‑Cost Tracking | LoRaWAN TDoA | Lange Laufzeit | Grobe Genauigkeit |
| Robotik | VIO + UWB | Stabil | Komplexität |
Bewährt hat sich ein stufenweises Vorgehen mit Piloten, klaren KPI (Genauigkeit, Verfügbarkeit, TTFF, Energie), Fallback‑Strategien und einem Lifecycle‑Plan für Firmware, Kalibrierung und Security‑Patches. Hybridansätze (z. B. UWB + INS, 5G + Kartenabgleich) erhöhen Resilienz, während Edge‑Verarbeitung und Datenminimierung Privacy‑Risiken reduzieren und Compliance erleichtern; die spätere Migration auf LEO‑basierte PNT oder neue 5G‑Funktionen wird durch modulare Hardware und abstrakte Schnittstellen erleichtert.
Was sind GNSS-Alternativen und warum gewinnen sie an Bedeutung?
GNSS-Alternativen umfassen terrestrische Funkortung, Trägheitssysteme, Signale von Gelegenheit sowie visuelle und akustische Verfahren. Sie mildern Abschattungen, Spoofing und Jamming, steigern Resilienz, Verfügbarkeit und Genauigkeit und sichern Dienste in kritischen Umgebungen, auch in Innenräumen.
Welche terrestrischen Ortungssysteme kommen in Frage?
eLoran bietet robuste, großflächige Zeit/Ort-Signale; UWB liefert zentimetergenaue Indoor-Positionen; LPWAN und RFID/Beacons ermöglichen Tracking mit geringem Energiebedarf. Pseudolite-Ansätze und DME-Referenzen ergänzen regionale Abdeckung. Funkfeuer entlang von Infrastruktur sowie terrestrische TDOA-Systeme erhöhen Verfügbarkeit in Städten und Häfen.
Welche Rolle spielen 5G und Wi‑Fi für Positionierung?
5G liefert NR-Positionierung über ToA, AoA und RTK-Assistenz, mit Netzwerkunterstützung und dichten Zellen. Wi‑Fi nutzt RTT (802.11mc/az) und Fingerprinting. Zusammen bieten sie dichte, kosteneffiziente Ortung in Gebäuden und urbanen Schluchten für zeitkritische Dienste und präzise Lokalisierung.
Wie funktionieren Trägheitssysteme (INS) als Ergänzung?
Trägheitssysteme messen Beschleunigungen und Drehraten mit IMUs und integrieren sie zu Trajektorien. In Sensorfusion mit Kartendaten, Barometer, Odometrie oder Vision überbrücken sie GNSS-Ausfälle, glätten Sprünge und liefern kontinuierliche, robuste, präzise Navigation auch unter schwierigen Empfangsbedingungen.
Welche Herausforderungen und Standards prägen den Markt?
Zentrale Herausforderungen sind Interoperabilität, Kalibrierung, Sicherheit gegen Spoofing, Datenschutz, Energieverbrauch und Kosten. Standards wie 3GPP Rel‑16+, IEEE 802.11az, eLoran-Spezifikationen und Assured PNT-Frameworks fördern Verlässlichkeit und Skalierung. Offene Schnittstellen und Zertifizierungen erleichtern Integration in Mission-Critical-Branchen.


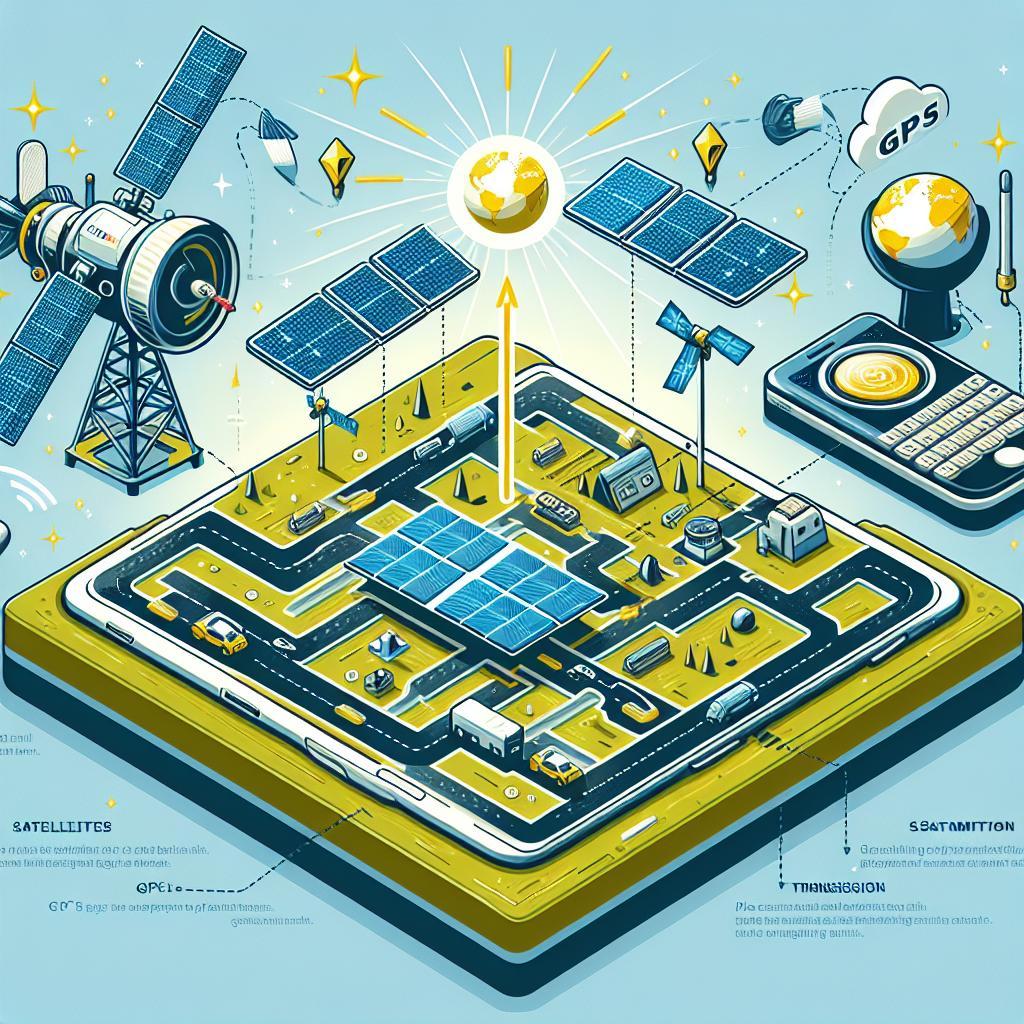

Leave a Reply